Hier mal echtes, leckeres und gesundes Fastfood. Die Herstellung – ich habe mal extra nicht fotografiert, sonst wäre es nicht so schnell gewesen – nahm keine 10 Minuten in Anspruch, das genussvolle Essen dauerte länger. Die Herstellung ist denkbar einfach: Hüftsteak in der gewünschten Menge auf eine einheitliche Dicke plattieren, mit Salz und Pfeffer würzen und in einer Eisenpfanne mit etwas Öl braten. Nebenher Salatherz waschen und putzen sowie auseinandernehmen und auf den Teller legen. Aus Ölivenöl, Balsamico-Essig, Salz, Pfeffer und einem Klecks Senf ein Dressing verquirlen, auf dem Salat verteilen. Zwischendurch wird das Fleisch einmal umgedreht.

Hat es den gewünschten Gargrad erreicht, kommt es mit auf den Teller und ruht dort noch ein paar Minuten. Dann kann angeschnitten und gegessen werden.

Sieht das nicht lecker aus?!
Karammmmmmmmmell
Süßer Zucker schmilzt langsam, aber nachhaltig, in einer erhitzen Pfanne. Erst wird er nur flüssig, von einer fast wasserhellen Flüssigkeit wandelt er sich, wenn man nicht aufpasst, in eine stinkende, schwarze Substanz. Aber wenn man zum richtigen Zeitpunkt Butter und/oder einen guten Schuss Sahne hinzu gibt sowie ggf. mit etwas Fleur del sel würzt, entsteht eine der leckersten Sachen, die man sich vorstellen kann: Karamell bzw. eine Art Karamell-Soße.
Das Gold der Küche, meist eher im Dessertbereich verwendet, ist doch immer wieder lecker. Die Möglichkeiten sind vielfältig. Sei es die knusprige Kruste auf einer Crème brûlée oder als Soße über einer Kugel Vanilleeis. Aber auch als geschmacksgebender Schuss Sirup in einem Latte Macchiatto ist Karamell sehr beliebt, wie eigene Erfahrung und Rücksprache in entsprechenden Fachgeschäften ergaben.
Den Karamellsirup kann man im Supermarkt seiner Wahl von einer Auswahl unterschiedlicher Hersteller erwerben.  Dortselbst habe ich jetzt auch eine Abart entdeckt, vermutlich einem Chemielabor entsprungen. Auf den ersten Blick fällt das noch gar nicht mal auf. Aber der zweite und spätestens der dritte Blick lassen dann doch erschrecken.
Dortselbst habe ich jetzt auch eine Abart entdeckt, vermutlich einem Chemielabor entsprungen. Auf den ersten Blick fällt das noch gar nicht mal auf. Aber der zweite und spätestens der dritte Blick lassen dann doch erschrecken.
Die hellblauen Streifen lenkten die Aufmerksamkeit doch recht schnell auf sich, da sie auch das Design des Etikettes stören. In der ausgewogenen Farbgebung des übrigen Aufdrucks wollen diese irgendwie nicht hinein passen. Aber da steht auch noch ein Wort drauf, dass den geübten Kulinariker noch mehr erschreckt.
Es sei nochmal daran erinnert, dass wir uns hier gerade über Karamell-Sirup unterhalten und woraus Karamall von Natur aus hauptsächlich besteht: Zucker. Zoomen wir also mal etwas weiter an das Etikett und dessen blaue Streifen heran:

ZUCKERFREI?! Was soll das denn? Chemie pur? Welchem „leichten“ Trend soll denn da wieder hinterhergehechelt werden? Sicher: Zucker und andere Kohlenhydrate sind maßgeblich für die Verfettung der Bevölkerung verantwortlich, weit weniger als Fett in den Nahrungsmitteln. Aber deswegen solche Simulantien auf den Markt zu bringen, schadet spätestens auch dem Markenimage.
Und ob eine Mischung aus Wasser, Weizendextrin, Aromen (mit Milchbestandteilen), Natriumcarboximethylcellulose, Zuckerkulör, Weinsäure, Sucralose, Acesulfam K, Kaliumsorbat so viel gesünder ist als Wasser, Zucker, Sahne?
Wenn man mal etwas mehr Zeit hat …
… kann man auch mal etwas aufwendiger kochen. Wobei der meiste Aufwand bekanntlich darin besteht, die Dinge gut zu fotografieren. Ansonsten wäre das Gericht schneller fertig gewesen. Aber eins kann ich aus eigener Erfahrung auch sagen: Wenn das Kochen nicht nur fotografiert, sondern auch gefilmt worden wäre, hätte es noch länger gedauert. 😉
Eigentlich könnte man das Gericht sogar jemandem widmen, dem größten Fan der Strindbergschen Zubereitung von Fleischgerichten, den ich kenne. Da das hier aber auch wieder nicht so ganz 100%ig á la Strindberg ist, lass ich es mal sicherheitshalber. Wobei sich die Frage stellt, was „á la Strindberg“ wirklich genau heißt.
Nimmt man die Frage recht locker, gehört auf jeden Fall Senf dazu. Aber dann wäre jede Bockwurst mit Senf auch Strindberg. Also fahren wir mal lieber etwas mehr auf:

Wir sehen: Parmigiano Reggiano, frischer Meerrettich, dreimal Senf (Chili-, Dijon- und mittelscharfer Senf), Schalotten, eine Knoblauchzehe und Kartoffeln. Diverse andere Zutaten kamen noch hinzu (Milch, Butter, Salz, Pfeffer, Muskat, Speck u.a.), waren aber zum Fototermin noch nicht geschminkt.
Zuerst wird der Senf mit dem frisch geriebenen Meerrettich vermischt.

Die Mischung ist persönlichen Vorlieben geschuldet. Eine Spur Curry hätte dieser Mixtur wohl auch gut getan, glaubt man der Fachliteratur.

Die Kartoffeln werden geschält, gewaschen und gegart. Sie sollen die Basis für einen Kartoffelbrei sein, der nach eigenem Gusto abgeschmeckt werden kann.
Zu einem guten Kartoffelbrei gehört warme Milch und Butter.

Hier geben wir die garen Kartoffelstücke und den Parmesan hinein und verarbeiten alles zu einem nicht zu festen, aber auch nicht zu flüssigen Brei.

Salz (wenig, wenn überhaupt), Pfeffer und Muskat runden den Pamms geschmacklich ab.
Die Schalotten und die Knoblauchzehe werden fein gewürfelt und im schmelzenden Speck in der Pfanne angebräunt.

Nun kommt das Fleisch in die Pfanne. Wichtiger Punkt hier ist, dass das Fleisch in der Pfanne nicht(!) garen soll (zumindest nicht beim Anbraten), aber schöne Bratspuren sind durchaus erwünscht. Also wird die Eisenpfanne genommen und ordentlich angeheizt. Hoch erhitzbares Öl hilft, das Ziel zu erreichen.

Schöne Röstaromen.

Die Pfanne kommt vom Feuer. Dann werden die Fleischstücke mit der Senf-Meerrettich-Mischung bestrichen und die angerösteten Schalotten darauf verteilt.

Der Kartoffelbrei kommt in eine Plastiktüte, die hier als Spritzsackersatz herhalten muss. Wer einen solchen Original sein eigen nennt, kann den natürlich auch benutzen.

Die Spitze wird abgeschnitten, so verteilt man den Kartoffelbrei einfacher auf den Fleischstücken.

Die Pfanne kommt jetzt in den Backofen unter den Grill, bis die Auflage gut angebräunt ist.

Es empfiehlt sich also, eine backofenfeste Pfanne zu nutzen. Natürlich kann man das Fleisch nach dem Anbraten auch in eine backofenfeste Form oder auf ein Backblech gehen.
Wer einen Ofen mit Einblick hat, kann jetzt am einfachsten einschätzen, wann die ganze Geschichte wieder unterm Grill raus muss.

Ich fand es so ganz angenehm. Einen Moment dauert es aber. Die Zeit kann man mit der Garnitur eines Tellers verbringen, wenn einem sonst nichts anderes einfällt. Dann wird es zum Anrichten jetzt einfach.

Guten Appetit.
Aufräumen und Essen
Manchmal sitzt man in der Küche auf dem Boden vor einem der Schränke und wühlt mal durch, was denn so alles an Küchengeräten im Laufe der Zeit ganz nach hinten gerutscht ist. Eine kleine stromlose Küchenmaschine kam dabei zum Vorschein.

Zusammen gebaut sah es dann so aus:

Gut, dass man immer ein paar Kartoffeln im Haus hat. Die waren schnell geschält und gewaschen.

Ein paar Runden mit der Kurbel gedreht, und schon sind die Kartoffeln geraspelt.

Die Mischung wird mit Salz und Pfeffer gewürzt. Hat man mehlig kochende Kartoffeln, ist man mit der Vorbereitung an dieser Stelle eigentlich schon fertig. Bei festkochenden und unbekannten Kartoffeln kann man sich der Hilfe eines Eis versichern.

Das alles wird gut miteinander vermischt, nachdem das Ei (ohne Schale!!!) hinzu gegeben wurde.
Jetzt kommt eine in mehrfacher Hinsicht passende Pfanne dazu.

Die Hinsichten sollten sich auf die Größe der Herdplatte, die Menge der geraspelten Kartoffel und der Existenz eines passenden flachen Deckels beziehen. Vor allem letzterer Punkt ist wichtig und wird noch anschaulich.
In die Pfanne kommt etwas Rapsöl und/oder Butter.

Dann wird die Raspelkartoffel hinzu gegeben und mittels einer Gabel gut angedrückt.

Nun wird alles nachhaltig, aber nicht zu stark erwärmt. Ziel ist es, den Rösti mit nur einmal Wenden zu garen und dabei nicht anbrennen zu lassen. Gezügelte Hitze ist jetzt also sehr wichtig. Und Geduld. Die Kartoffelscheibe soll goldgelb anbräunen und die untere Hälfte auch garen. Und Kartoffeln garen nicht so schnell. Also Ruhe, Besonnenheit und nicht zu viel Hitze.
Jetzt kommt der Deckel ins Spiel. Nachdem man sich durch leichtes Rütteln an der Pfanne davon überzeugt hat, dass der Rösti lose ist, kommt der passende Deckel über den Pfanneninhalt.

Liegt der Deckel richtig drauf, hält der den Pfanneninhalt im Bratgerät und man kann beides an Griff und Henkel anfassen. Dadurch wird das Wenden zu einem Kinderspiel. Der Rösti liegt dann auf der Innenseite des Deckels; man kann dann die Pfanne nochmals etwas einfetten und das Kartoffelgericht langsam vom Deckel in die Pfanne rutschen lassen.

Anschließend wird er noch wieder etwas angedrückt und gart dann von der anderen Seite.

Das erfolgt auch wieder mit Geduld und leicht gebremster Hitze. Ist der Rösti gar, rutscht er förmlich auf einen vorgewärmten Teller, so dass man noch schnell eine Beilage in der noch heißen Pfanne zaubern kann. Hier sind es ein paar Zuckererbsen, die in etwas Butter/Öl geschwenkt werden und zwei halbierte Tomaten, die auf der Schnittfläche leicht karamellisieren.

Nun kann alles angerichtet werden.

Natürlich könnte man noch einen Klecks Kräuterquark, ein Stück Sülze oder etwas Salat dazu reichen. Auf jeden Fall: Guten Appetit.
Mit dem Gyro(s)kop(ter) unterwegs
Der Name Gyroskop kommt als Wort ja aus dem griechischen (γύρος „Drehung“ und σκοπεῖν „sehen“). Gyrokopter sind sogenannte Drehflügler, die im Gegensatz zum Hubschrauber zwar einen Rotor oben haben, der Antrieb erfolgt aber durch einen Propeller oder etwas ähnliches. Der Rotor hat keinen Motor. Aber die flugtechnischen Gedanken führen etwas vom Thema ab. Setzen wir uns also in das Fluggerät, mit dem Gyroskop am Auge, also mit dem Drehfleischsucher, und entdecken griechische Speise.
Das ist, wenn man gewisse Qualitätsansprüche unterstellt, gar nicht so einfach. Zweimal luden in der letzten Zeit entsprechend gastliche Stätten zur Einkehr ein, und, um das Ergebnis vorweg zu nehmen, es wird bei den jeweils einmaligen Besuchen wohl auch bleiben, wenn auch aus völlig verschiedenen Gründen. Vernünftiges Gyros ist in der Region augenscheinlich Mangelware, wo bei es, wäre es wirklich durch eine Mangel geraten, Dönerfleisch nicht unähnlich geworden wäre.
Verkehrsgünstig gelegen ist das griechische Restaurant in Prenzlau: Es hat seinen eigenen Bahnhof. Ob es daran lag, dass das Gyros ein bisschen so aussah, als ob es mehrfach überfahren, war nicht nachzuprüfen. Gut gesprengt war es jedenfalls. Während die Aromen durchaus anzunehmen waren und die herzliche Atmosphäre fast schon ins Intime ging (Ringelpitz mit Anfassen), war die Konsistenz des griechischen Fleischgerichtes entweder völlig vom Weglassen eines Drehspießes bestimmt, oder man hat sich große Mühe gegeben, das im nachhinein zu kaschieren.
Völlig anders zeigte sich das Gyros im griechischen Restaurant in Weisdin. Die Struktur erinnerte schon eher an das, was man erwarten kann. Erfreulich war auch zu nennen, dass die manchmal doch etwas sperrigen Gemüsezwiebelringe fehlten, die anderswo wohl zur Standardausstattung gehören. Auch war das gesamte Gericht sehr ausgewogen gewürzt: Was den Pommes an Salz fehlte, war dafür im Fleisch überreichlich vorhanden. Vielleicht machte es auch dadurch einen etwas angetrockneten Eindruck, hat Salz doch eine hygroskopische Wirkung.
So bleibe ich weiter auf der Suche nach einem Laden – mittlerweile muss es auch kein Imbiss mehr sein – der ein geschmackvolles, leckeres Gyros anbietet. Mit der Frage nach einem entsprechenden Laden hat ja mal der Blog „RundumGenuss“ beinahe angefangen … Es war der 4. Artikel überhaupt.
Butterbrotwettbewerb
An dieser Stelle mal ein Hinweis auf einen anderen Blog, der durchaus etwas heraus gestellt werden darf. Heike von Heikes Blog hat aktuell einen kleinen Butterbrotwettbewerb im Programm. Die Zusammenfassung darf gern bestaunt werden. Wer es durch die zahlreichen Varianten bin an das Ende der Seite geschafft hat, wird dort den Grund entdecken, warum ich so direkt auf Heikes Blog hinweise. 😉
Alles ist irgendwann das erste Mal – Die Sache mit dem Apfel
Beinahe hätte mein erster Backversuch so ausgesehen, als ob nicht mal was gebacken worden wäre. Oder wie anders ist zu erklären, dass das erste Bild dieser Fotokochstory eine Pfanne auf dem Herd darstellt.

Beim Nachkochenbacken sollte man streng darauf achten, dass die Pfanne auch backofenfest ist.
Das Rezept ist übrigens geklaut, aber auch abgewandelt. Irgendein Fernsehkoch hatte mal was ähnliches in einer Sendung. Ähnlich wie bei ihm kommt auch hier Zucker in die und Hitze unter die Pfanne.

Das dauert je nach Pfanne etwas. Man muss auch im weiteren Verlauf gut aufpassen, nichts verbrennt so schnell wie ein Karamell.
Irgendwann fängt der Zucker an zu schmelzen.

Jetzt heißt es, hochkonzentriert zu sein. Wir wollen schließlich ein Karamell und keine verbrannte Pfanne. Speichert diese die Wärme eher sehr gut, hilft es, sie etwas früher von der Herdplatte zu nehmen, damit kein Rauch aufsteigt. Aber spätestens, wenn der geschmolzene Zucker anfängt zu bräunen, kommt die Pfanne vom Herd.

Kundige Helferlein (oder man selbst vorher) haben zwei Äpfel in Spalten geschnitten. Die werden jetzt möglichst dicht auf den Pfannenboden ins Karamell gelegt.

Um dem kommenden Kuchen noch etwas Pfiff zu geben, kann man jetzt etwas veredeln: Mandelstifte, Rosinen oder andere Beigaben sind denkbar. Hier werden ein paar grob gehackte, getrocknete Cranberrys verwendet.

Die Helferlein oder wer auch immer haben jetzt ein Stück Hefeteig (fertig, Tiefkühler) auf Pfannengröße ausgearbeitet. Im Original wurde Blätterteig aus gleicher Quelle genutzt. Der Teig bildet einen Deckel über dem Obst.

Hefeteig muss nun noch etwas gehen, dazu wird er abgedeckt.

Blätterteig hat das nicht nötig. Der wurde dafür, wenn ich mich richtig erinnere, etwas mit der Gabel traktiert, damit er nicht zu doll aufgeht. Die Gehzeiten des Hefeteiges findet man auf seiner Packung.

Nun kommt die Pfanne in den Ofen, der je nach Tiefkühlpackungsbeschriftung eingestellt ist. Bei dem Hefeteig waren es 180°C Umluft und 20 Minuten. Danach sah es in der Pfanne so aus:

Spätestens jetzt stellt sich die Frage, ob der Kuchen, will man das ganze so nennen, gelungen ist. Zum Verzehr wird er gewendet, was aber vor dem endgültigen Auskühlen erfolgen sollte. Unten befindet sich der Karamell, der sonst u.U. an der Pfanne klebt. Mit Schwung gehts auf den Teller.

Und der spannende Moment ist da: Kommt er raus oder nicht? Er kommt.

Nicht sonderlich schön, aber lecker. Ein Klecks Schlagsahne oder vielleicht eine Kugel Zitronensorbet wären eine schöne Beilagenidee.
Vermutlich lässt sich das Rezept auch mit Birnen, Pflaumen und anderen halbwegs fest bleibenden Obstsorten verwirklichen. Viel Spaß beim Experimentieren und guten Appetit.
Sie ist da: Kochen stilecht
Damit hier mal stilecht gekocht werden kann, ist sie jetzt endlich angekommen: Die Herdnerd-Küchenschürze. Da kocht man doch gleich noch mal so gern.

Dann spiegelt sich wenigstens nichts verbergenswertes in irgendwelchen Topfdeckeln. 😉
Klassiker auf Hobel
Da sieht man was im Fernsehen und liest kurze Zeit einen Blogbeitrag und dessen Kommetare und bekommt plötzlich Synapsenverklebung, in dem man beides, was auf den ersten Blick vielleicht nicht so direkt passen möchte, miteinander verbindet. Versuchen kann man es ja mal. Da stellt sich die Frage, was passiert, wenn ein Klassiker regionaler Küche auf das hier trifft:
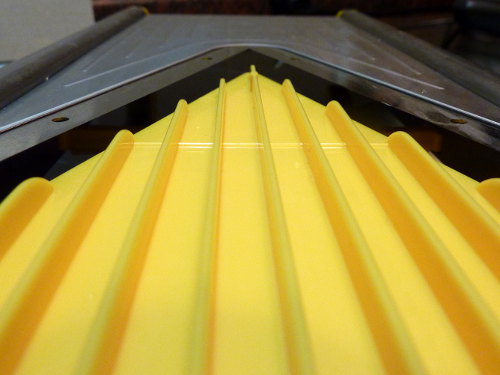
DEN GEMÜSEHOOOOOBEL. 😉
Aber anfangen tut das Rezept ganz klassisch, in dem wir ein paar Zwiebel- und ein paar Würfel durchwachsenen Speckes in eine heiße Pfanne geben und sie etwas ausbraten.

Sind Speck und Zwiebel ausgelassen und ggf. leicht angebräunt, stellt man sie beiseite.

Nun greift man einen hitzefesten Teller.

Nicht, dass jetzt einer sagt, ich hätte den Teller vor der Verwendung ruhig sauber machen sollen. Der sieht ganz schmierig aus. Das tut er zu Recht, wurde die kreisrunde Mitte mit etwas Öl (Raps oder Olive) bepinselt.
Nebenher kam übrigens der Gemüsehobel zum Einsatz. Die beiden dünn gehobelten Früchte kommen jetzt auf den Ölspiegel auf dem Teller und werden auch von oben etwas beträuftelt und gesalzen.

Bevor das große Rätselraten los geht, sei verraten, dass sich hier rohe Kartoffel- und säuerliche Apfelscheiben auf dem Teller abwechseln. Damit wird auch schon fast klar, welchen Klassiker wir hier hauchdünn aufgeschnitten haben.
Der Teller kommt samt Auflage unter den Grill.

Dort verbleibt es, bis die Kartoffelscheiben gar sind. Das kann einen Moment dauern. In der Zwischenzeit wird die Beilage zum Klassiker vorbereitet.

Ein paar Blutwurstscheiben werden dünn mehliert und dann in der Pfanne kurz angebraten, dass sie von außen braun werden, aber nicht zerfallen.

Heiß und schnell wird also gearbeitet.

Die Versuche zeigen, dass die Kartoffel-Apfelscheiben-Teller-Kombination ca. 10 Minuten unterm Grill sein sollte. Das Exemplar auf dem nachfolgenden Foto war weniger lang den heißen Strahlen ausgesetzt, deswegen sieht es noch etwas blond aus und die Kartoffeln waren stellenweise noch al dente.

10 Minuten im geschlossenen Grill (bei einem zweiten Versuch) ergab gebräunte und gare Zutaten.

Machen wir aber mit der ersten Variante weiter. Der Teller wird aus dem Grill genommen (Vorsicht: Der Teller ist sehr sehr sehr sehr heiß!) und dann kann mit der Zwiebel-Speck-Mischung und der Blutworscht verziert werden.

Fehlt nur noch ein Namen für das Gericht.
Carpaccio von Himmel und Erde mit Blutwurst
Man konnte es essen. Irgendwie muss ich das Original nochmal studieren, um diesem Gericht etwas mehr Saftigkeit zu geben. Aber eine Idee ist es.

Guten Appetit.
Pimp my Abendbrot – Leberwurststulle
Pimp my Leberwurstbrot – Oder, wie der Berliner sagen würde: Mach ma Appel bei die Leber. Und so beginnt die Geschichte mit einer kleinen Pfanne, die auf den Herd gestellt und angeheizt wird.
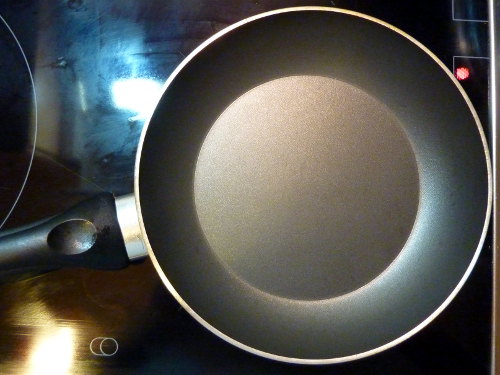
In die Pfanne kommt etwas Fett, das kann ruhig Butter sein, allerdings sollte die Pfanne dann nicht so stark erhitzt werden.

Schalotte und ein säuerlicher Apfel werden fein gewürfelt und in die schmelzende Butter gegeben.

Es sollte nicht zu viel umgerührt werden. Etwas Bräune ist erlaubt. Der Pfanneninhalt wird mit je einer Prise Salz und Zucker gewürzt.

Kommen wir zum Hauptdarsteller des Abends: Die Leberwurst. Persönlichen Vorlieben kann hier nachgegangen werden. Ich ziehe eine grobe Leberwurst ohne Schnickschnack vor.

Als erstes wird das Brot oder Brötchen der Wahl mit der Wurst beschmiert.

Dann kommt ein oder zwei Esslöffel voll von der Apfel-Zwiebel-Pfanne hinzu.

Und dann bleibt nur noch eins:

Mmmh. Lecker. Wer mag, kann auch noch eine Variante anbringen. Dabei wird die noch leere Brötchenhälfte bzw. die Stulle hauchdünn mit Senf überkratzt.

Empfohlen wird der einzig wahre Senf. 😉 Der Rest ist dann genau wie bei der anderen Hälfte: Darauf die Wurst (Vorsicht, dass man den Senf nicht zusammenschiebt!) und zwei Esslöffel vom Pfanneninhalt.

Guten Appetit.
